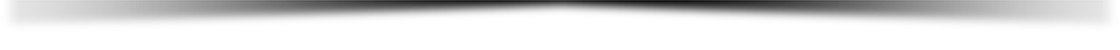Was den Anwohnern und Ausflüglern vom Wirken des legendären „Heiden-Heinrich“ blieb, war – neben der Erinnerung und zahlreicher Anekdoten – das heutige Strandbad.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es an der Ostflanke des Orankesees eine wilde Badestelle. Doch plötzlich waren Strandbäder der „letzte Schrei“. Und alle wollten ein solches haben. Am Wannsee baute man bereits seit 1907. In Weißensee eröffnete 1912 die „Gemeindebadeanstalt“.
Für ein Strandbad in Hohenschönhausen veranschlagte man Kosten in Höhe von 150.000,00 Reichsmark, die der Magistrat dem Bezirk nicht bewilligte.
Und hier kam „Heiden-Heinrich“ ins Spiel. Der bewarb sich 1929 als Pächter für das Wirtshaus. Um seine Offerte zu versüßen, versprach er den Bau eines Strandbades sowie die Finanzierung desselben aus seiner eigenen Tasche.
Und hielt Wort! In enger Zusammenarbeit mit den städtischen Behörden ließ Heiden-Heinrich noch im selbem Jahr das Bad errichten. Die Baubehörde und das Gartenamt gestalteten die Uferpromenade. In Friedrichsfelde wichen zur selben Zeit viele Häuser dem U-Bahn-Bau. Das Abbruchmaterial benutzte man zur Aufschüttung der Uferpromenade hier am See.
Und da nichts mehr Neugierde weckt, als Dinge vom Hören-Sagen, so verbreitete sich schnell das Gerücht: Den wunderbaren weißen Sand hätte man „extra“ von der Ostsee angefahren! Doch in den „Weißenseer Nachrichten“ las man dazu später ganz lapidar:
„Aus den Baugruben der Hochhäuser am Alexanderplatz schaffte man wagenweise weißen Sand heran.“
Voilà! Der Sandstrand ist übrigens 250 Meter breit und die Liegewiese erstreckt sich über 8.000 m².
Von 1969 bis 2003 wirkten hier dann Evi und Uwe Bröse. Er als „Badebetriebsleiter“, sie als „Referentin für Naherholung für die Freibäder, Hallenbäder und Wannenbäder im Bezirk“. Da Evi ebenfalls ausgebildete Schwimmlehrerin war, traf man sie freitags bis sonntags neben ihrem Mann im Strandbad an. Zahlreiche Neuerungen, Umbauten und der Einzug von Kunstwerken ins Bad gingen auf ihre Kappe. – Und heute? Auch in den letzten Jahren gewann das Bad noch mal deutlich an Attraktivität. Die Besucherzahlen steigen. Das „Herz“ von und hinter allem ist die Pächterfamilie um Alexandra Barnewski. Und Alexandra Barnewski erzählt:
“Wir haben wirklich ein sehr, sehr liebes und nettes Publikum. In letzter Zeit auch internationales Publikum. Spanier, Italiener, Norweger, Finnen, Touristen oder hier Arbeitende… Man sieht die Kinder aufwachsen… Jedes Jahr werden sie ein Stück größer und plötzlich haben sie selbst Kinder…”
Das Strandbad am Orankesee
(von Bärbel Ruben)
Der Orankesee ist ein Geschenk der Eiszeit. Sein Name klingt geheimnisvoll und einmalig. Der See erhielt ihn erst vor etwa 150 Jahren. Ein Kartograph zeichnete ihn 1872 als „Orrankesee“ (noch mit Doppel-r) auf ein „Messtischblatt“. 1849 dagegen wurde er noch als Rohrpfuhl bezeichnet.¹
Zur Herkunft des Namens Orankesee geben Namensforscher folgende Erklärung: Da unser Gebiet ursprünglich von slawischen Stämmen bewohnt war, benutzten diese den Namen „Rodranka“ als Bezeichnung für den „rotbraunen kleinen See“. Im Laufe der deutschen Eroberung und Besiedlung, die im 10. Jahrhundert einsetzte, wurde aus „Rodranka“, „Roderranka“, „Rohrranke und schließlich der „Orankesee“.²
Der See misst 4,7 Hektar, ist also verhältnismäßig klein und auch nicht sonderlich tief. Drei bis max. sechseinhalb Meter benötigt ein Taucher um auf seinen Grund zu stoßen.
Die gesamte Ostflanke des Sees nimmt das Strandbad ein. Der lange Sandstrand mit den aneinander gereihten Strandkörben und die schattige Liegewiese mit ihrem prächtigen Baumbestand dominieren die heutige Prägung des Sees als eines der beliebtesten Badegewässer im Osten Berlins. Das war jedoch nicht schon immer so.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es ganz in der Nähe des Wirtshauses am Orankesee eine Badestelle. Aber ein richtiges Strandbad fehlte.
Strandbäder entstanden seit der Wende zum 20. Jahrhundert überall in Berlin und Umgebung. In Wannsee ging es bereits 1907 mit der Buddelei los und im benachbarten Weißensee eröffnete schon 1912 eine „Gemeindebadeanstalt.“
Es war nur noch eine Frage der Zeit für ein Freibad im Ortsteil Hohenschönhausen, aber es fehlte das Geld. 150.000 RM versuchte der Bezirk Weißensee von den Ratsherren im Berliner Magistrat locker zu machen um eine wirklich großzügige Badeanlage erbauen zu können. Die Mittel wurden jedoch nicht bewilligt.
Die Verwirklichung des Traums vom eigenen Hohenschönhausener Strandbad ist dem Geschäftsmann Wilhelm Heiden-Heinrich zu verdanken. Als er sich im Februar 1929 um die Neuverpachtung des Wirtshauses am Orankesee bei der Weißenseer Bezirksverwaltung bewarb, bot er zugleich an, auf eigene Kosten ein Strandbad zu errichten.³ Und so entstanden nach Entwürfen der Bauverwaltung die gesamten Anlagen im Wert von 53.000 RM, die Wilhelm Heiden-Heinrich aus eigenen Mitteln aufbrachte. Das Bezirksamt konnte sich lediglich mit 10.000 RM am Gesamtprojekt beteiligen. In enger Zusammenarbeit mit den städtischen Behörden ließ Heiden-Heinrich noch im selben Jahr – also 1929 – das Bad errichten. Die Baubehörde und das Gartenamt unter seinem rührigen Leiter Paul Henke legten die Uferpromenade um den Orankesee an. Diese Promenade mit Namen Orankestrand wurde übrigens mit Abbruchmaterial von Häusern aufgeschüttet, die dem U-Bahnbau nach Friedrichsfelde weichen mussten.
Zehn Jahre später erinnerte sich ein Weißenseer Reporter:
„Der Wasserspiegel des Sees wurde gesenkt und die Uferböschung dauerhaft befestigt. Der angefahrene Schutt festgestampft und mit Kies belegt, Bäume und Hecken angepflanzt und auch die dem See zur Zierde gereichende Brücke für die Zu- und Abflussregelung gebaut. Aus den Baugruben der Hochhäuser am Alexanderplatz schaffte man wagenweise weißen Sand heran.“⁴
Später entstand die sich bis heute hartnäckig haltende Legende, dass der Sand des Orankebades bis aus dem Ostseebad Ahlbeck geholt worden sei. Wer dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat, wissen wir nicht. Vielleicht war es Wilhelm Heiden-Heinrich selbst? Echter Ostseesand am Orankestrand – was für ein toller Werbe-Gag!
Der Sandstrand ist übrigens 250 Meter lang und die Liegewiese war in ihrer Entstehungszeit 8.000 Quadratmeter groß.
Zum Strandbad gehörten damals auch ein Sprungturm, ausgedehnte Garderobenräume und beeindruckend viele Fahrradständer, die in den dreißiger Jahren bereits 1.500 (!) „Drahtesel“ aufnehmen konnten und als absolut vorbildlich galten.⁵
Was Heiden-Heinrich in Rekordzeit schuf, war bald in aller Munde. Die Berliner Presse fand nur lobende Wort für das neue „Badeparadies des Berliner Nordostens.“ Im Juni 1929 konnte das Bad bereits eröffnet werden. Zehntausende Besucher strömten an den folgenden Wochenenden ins Orankebad.⁶
Es waren herrliche Zeiten, bis gegen Ende des 2. Weltkrieges die Bomben fielen. Auch das Bad wurde schwer getroffen. In der Nacht vom 2. zum 3. Januar 1944 wurde es völlig zerstört. Im Juni 1944 fielen auf das behelfsmäßig wiederhergestellte Bad erneut Bomben, von da an blieb es geschlossen.⁷
Nach dem Krieg mussten Bombentrichter rund um den See beseitigt werden und der See musste dringend von Munition, Schutt und Leichen beräumt werden.
An einen Wiederaufbau des zerstörten Strandbades war jedoch nicht zu denken, denn sein Terrain wurde zusammen mit dem Wirtshaus in das sowjetische Sperrgebiet mit einbezogen, das Ende 1945 entstand.
Erst als die letzten Absperrungen fielen und die sowjetische Armeeführung das Sperrgebiet aufgab, konnten Wiederaufbaupläne reifen. 1951/52 war es endlich soweit. Die durch das Militär heruntergewirtschafteten Örtlichkeiten wurden wieder durch die Bezirksverwaltung Weißensee übernommen. 1954 beschloss diese die Wiederherstellung des Freibades. Zunächst musste der Orankesee leergepumpt werden und endgültig von noch immer hier lagernder Munition, Kriegsschutt und Unrat gereinigt werden. Die Schwarzeinläufe in den See wurden verdichtet. Die Ufer- und Wiesenbereiche einmal mehr mit Trümmerschutt aufgefüllt.
Die Neuerrichtung des Bades dauerte dann noch vier ganze Jahre! 300.000 Mark, die größtenteils aus Mitteln der „Berliner Bärenlotterie“ kamen, wurden mit dafür eingesetzt. Unterstützt wurden die Arbeiten durch viele Aufbauhelfer aus den inzwischen volkseigenen Betrieben, der Volkspolizei und besonders der Jugendorganisation der DDR, der Freien Deutschen Jugend – FDJ.⁸
In dieser Wiederaufbauphase wurde auch ein neuer Tiefbrunnen für die Frischwasser-zufuhr gebaut.
Am 1. Mai 1957 gab es ein festliches Anbaden und mit dem Saisonbetrieb 1958 wurde das Strandbad für die Öffentlichkeit offiziell als „Naherholungsobjekt“ freigegeben.
Einem Schwimmmeister-Ehepaar muss hier unbedingt ein Denkmal gesetzt werden: Eveline und Uwe Bröse. Uwe Bröse war von 1969 bis zu seiner Berentung im Jahr 2003 als Badbetriebsleiter tätig, seine Frau Evi Bröse war als Referentin für Naherholung für die Freibäder, Hallenbäder und Wannenbäder im damaligen Bezirk Weißensee verantwortlich. Da Evi Bröse ebenfalls ausgebildete Schwimmlehrerin war, traf man auch sie im Saisonbetrieb von Freitag bis Sonntag neben ihrem Mann im Bad an. Über 25 Jahre lang waren beide gemeinsam für die Verwaltung des Strandbades verantwortlich. Unter ihrer Leitung gab es mehrere Umbauten und viel Eigeninitiative.
1972 kam ein neuer Rettungsturm mit Erster Hilfe-Station ins Bad. Er ist noch heute in seinem blau-gelb stilprägend. Wenig später wurde der Eingangsbereich des Bades umgestaltet. Der ehemalige Kassenbereich mit seinen drei kleinen Fenstern am Eingangsgebäude wurde zugemauert und durch ein neues Kassenhäuschen ersetzt.
Die Eingangsfront des Gebäudes war dadurch frei für künstlerische Gestaltung und bekam ein Kachelgemälde mit Badeszenen. Und die Bröses kümmerten sich darum, dass weitere Kunst ins Bad kam.
Seit 1974 ergänzen Rosenrabatten neben dem Koniferenbereich das gärtnerische Ambiente des Bades.
Bis zum Beginn der 1970er Jahre besuchten in einer Badesaison zwischen 100.000 bis 130.000 Besucher das Strandbad am Orankesee. In den darauffolgenden Jahren bis zur Wende gab es eine ständige Steigerung der Erholungssuchenden, insbesondere als in den achtziger Jahren große Neubaukomplexe in Hohenschönhausen entstanden, was 1985 zur Gründung des eigenständigen Stadtbezirks Hohenschönhausens führte. Nun hatten die Besucherzahlen bereits die 200.000er Marke geknackt und im Rekordjahr 1989 wurden sogar 336.627 Badegäste gezählt! An heißen Tagen tummelten sich 7.000 bis 10.000 Sonnen- und Badehungrige im Strandbad Orankesee.⁹
Eveline Bröse erinnert sich:
„Der Ansturm auf das Strandbad in den Vorwendezeiten war gewaltig. Die Leute standen schon lange vor der Badöffnung an, um einen der begehrten Strandkörbe zu ergattern. 10 Minuten nach unserer Eröffnung waren die 120 Strandkörbe – sie kosteten zwei DDR-Mark für den ganzen Tag und eine Mark für den halben – bereits verliehen, wer keinen mehr bekommen hatte, konnte sich eine Campingliege für eine Mark ausleihen oder begnügte sich mit einem Liegestuhl für 60 Pfennige. Der Eintritt kostete bis 1989 ganze 20 Pfennige für die Erwachsenen und 10 Pfennige für die Kinder. Gruppen kamen kostenlos ins Bad. Da macht natürlich Baden und Toben doppelt Spaß.“¹⁰
In den Nachwendejahren gingen die Besucherzahlen erst einmal sehr stark zurück, denn vielen Menschen stand jetzt erstmals die Welt offen und sie suchten sich andere Ziele. Die Strandkörbe waren nun nicht mehr knapp, dafür allerdings die PKW-Parkplätze vor dem Bad. Und am Samstagvormittag gab es auch keine langen Schlangen vor dem Kassenhäuschen mehr, denn eine andere Beschäftigung wurde Mode: „Shoppen gehn“.
1993/94 wurde das Strandbad für 870.000 DM durch das Hochbauamt Hohenschön-hausen saniert. Als besondere Attraktion bekam das Bad zum Saisonstart 1994 die große Ringelrutsche „Elsa“. Diese erfreut sich bis heute großer Beliebtheit.
1996 änderte sich die Rechtsträgerschaft für die ehemals kommunalen Berliner Bäder. Sie wurden aus dem Vermögen der Bezirke in den Bestand der neu gegründeten Landesanstalt Berliner Bäder Betriebe übergeben. Im Jahre 2002 wollten die Bäder Betriebe dann die Strandbäder loswerden und schrieben sie zur Verpachtung aus.
Beworben hatte sich das Gastronomenehepaar Barnewski. Im Bad waren die beiden bereits als Imbissbetreiber etabliert und wagten nun einen ziemlich großen Sprung ins kalte Wasser.
Inzwischen ist die Familie um Alexandra Barnewski genauso eine „Institution“ wie vor dem die Bröses. Wahrscheinlich ist diese Kontinuität auch das Erfolgsrezept für das Bad.
Es ist ein Familienbetrieb mit dem Sohn als Geschäftsführer und Rettungsschwimmer zugleich. Daneben arbeiten viele Saisonkräfte, die jedes Jahr aufs Neue angeworben werden müssen.¹¹
Alexandra Barnewski: „Am Ende der Saison sind alle wieder weg. Jedes Jahr im April suchen wir wieder neue Kräfte.“
Die Bäder Betriebe unterzeichneten 2018 erneut den Pachtvertrag mit Alexandra Barnewski. So hat sie Planungssicherheit auch für weitere verpflichtende bauliche Investitionen.
In einer Pachtperiode kam es zur Erneuerung der sanitären Anlagen, dann kamen neuen Duschen und der neue Steg an die Reihe. Zu tun ist immer etwas.
Alexandra Barnewski:
„Was mir an dem Bad gefällt ist, dass es klein und übersichtlich ist. Das Wasser ist sauber. Wir haben wirklich ein sehr, sehr liebes und nettes Publikum. In letzter Zeit auch internationales Publikum. Spanier, Italiener, Norweger, Finnen, Touristen oder hier Arbeitende… Man sieht die Kinder aufwachsen… Jedes Jahr werden sie ein Stück größer und plötzlich haben sie selbst Kinder…“
Der Orankesee ist einer der saubersten Badeseen Berlins. Eine außer in den Winter-monaten täglich arbeitende Unterwasserpumpe versorgt den See aus 30 Meter Tiefe mit Frischwasser. Davon profitieren Mensch und Tier. Der See gilt als fischreich und ist auch ein ausgewiesenes Angelgewässer, betreut durch den Deutschen Anglerverband Berlin.
² Hermann Schall, Der Name Orankesee, Märkische Heimat, Heft 2, 1962.
³ Akten über die Neuverpachtung des Wirtshauses am Orankesee, Landesarchiv Berlin, Rep. 48-08, Nr. 202.
⁴ Berliner Nordostzeitung, 1. Beilage, 2. Juni 1939.
⁵ ebenda
⁶ Freibadfreuen in Hohenschönhausen, Hohenschönhausener Lokalblatt, 27. Juni 1929.
⁷ Tagebuchaufzeichnungen von Wilhelm Heiden-Heinrich. Familienbesitz. Kopien im Museum Lichtenberg im Stadthaus, Bestand Heiden-Heinrich.
⁸ Vgl. u.a. Weißenseer Nachrichten, 23.2.1957, Nr. 1/1957.
⁹ Vgl. Kleine Chronik über das Strandbad am Orankesee, Mai 1919, Zusammengestellt von Eveline Bröse.
¹⁰ Gespräch der Autorin mit Eveline Bröse im Juni 2018.
¹¹ Gespräch der Autorin mit Alexandra Barnewski im Juni 2018.